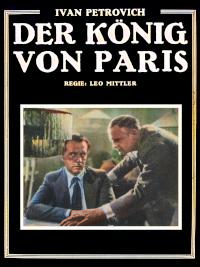
Originaltitel: Der König von Paris. Hochstaplerdrama 1930; 72 min.; Regie: Léo Mittler; Darsteller: Iván Petrovich, Hanna Ralph, Hans Peppler, Hanna Waag, Rolf von Goth, Karl Etlinger, Charles Puffy; Greenbaum-Tobis-Film.
Ein alter Brillantendieb lanciert einen armen Teufel in Paris als Südamerikanischen Nabob, beraubt vorher einen Juwelier, kommt aber nicht zum entscheidenden Coup, der Ausplünderung einer liebesbedürftigen Herzogin. Dies, da sich sein Werkzeug inzwischen in deren zukünftige Schwiegertochter verliebte und ihm die Behörden auf der Spur gekommen. Der Juwelendieb wird von dem Pseudoamerikaner im Streite erschlagen, während dieser selbst mit Hilfe der Herzogin ins Ausland flieht.
Zusammenfassung
Ein junger Südamerikaner, Pedro d’Alvarzez, lernt in einem Spielklub einen Mann namens Rascol kennen. Rascol schlägt Pedro vor, ihn binnen weniger Wochen zum bekanntesten Mann der Pariser Gesellschaft zu machen. Die geheime Absicht Rascols ist, Pedro mit der nicht mehr jungen, dafür aber millionenreichen Herzogin von Marsignac zu verheiraten.
Voll Besorgnis verfolgt der Sohn der Herzogin, Henry, die Intrige, die er durchschaut. Henry vertraut sich der ihm eng befreundeten jungen Lucienne an, und sie beschließen, mit Hilfe eines Kriminalbeamten, Pedro eine Falle zu stellen. Pedro hat sich in Lucienne verliebt und will gegen den Willen Rascols die Beziehungen zur Herzogin abbrechen. Lucienne folgt einer Einladung Pedros in seine Wohnung. Als er ihr aber seine Liebe erklärt und sich über die alternde Herzogin lustig macht, steht die Herzogin plötzlich auf der Schwelle des Zimmers. Kurze Zeit später erscheinen Henry und der Kriminalbeamte, um Pedro zu verhaften. Da lernt Pedro die Größe der Herzogin kennen: sie läßt ihm einen falschen Paß, Geld und einen Fahrschein nach Südamerika einhändigen, damit er die Möglichkeit habe, zu fliehen und drüben ein neues Leben zu beginnen.
Kritik (E. J., Film Kurier #177, 07/29/1930):
Viele gute Vorsätze ergeben noch nicht immer eine gute Tat. Bei dieser Produktion hat es viele gute Vorsätze gegeben.
Man steuert nun aber auf das gefürchtete mondäne Abenteuerfilm-Genre hin, um dem Pariser Geschmack und dem deutschen gleichzeitig gerecht zu werden, versucht jene unwahren, faden Salon-Verbrechergeschichten mit Ton und Sprache zu versehen, die schon in der stummen Aera kaum interessieren konnten. Dieses Paris, diese Verbrecher und Spieler, diese simplen Figuren, Ausgeburten ausgeleierten Phantasien, geschätzte Autoren Curt I. Braun und Michael Linsky – ein solches trauriges Schreibmaschinenfabrikat hätte man schon früher nicht mit einem Sous bezahlen dürfen. Man hats aber getan.
Als solche Filmwelt stumm war, konnte sie blenden und geistig Armen für 60 Sekunden eine Scheinwelt vorgaukeln. Doch die Sprache entlarvt.
Wenn früher ein zaghaft blödes Mädel nachmittags um fünf zum Starhelden in seinen edel möblierten Salon trat, blieben wir davor geschützt, anzuhören, was sie schwätzen. Heute reden diese Leinwandherven – und es gibt eine doppelte Desillusion, einmal hört man, daß der Star wie ein Handlungskommis stottert und als Held im Film redet er auch Blech, Ade, Romantik der stummen Schwarz-Weiß-Märchen.
Beim stummen Film träumte der Beschauer gern die Vollendung dessen, was er sah, hinzu. Das gefährliche Ohr entdeckt aber, daß sie auch auf der Leinwand allzumal Sünder sind.
Es gibt nur einen, der Sünden- und Durchfälle verhüten kann: Den Erfinder des Films, gleichgültig, ob er der Autor oder Dramaturg, Dichter oder Produktionsleiter heißt.
Deutlich ist dieser Abenteurergeschichte anzusehen: Alles war da, nur eine Idee nicht, um deretwillen man filmte. Auftrag lag vor und statt des Einfalls wurde die Konstruktion gesetzt, der Film ist nicht erfunden, er ist konstruiert. Und bei der Komposition, der Durcharbeitung, hat man auf alles Rücksicht genommen, nur eben wieder nicht auf Idee und Handlung.
Leo Mittler hat sich mit Curt Courant und Max Brinck als tüchtige stumme Routiniers ganz auf die olle ehrliche gute alte Kamera verlassen. Sie „brilliert“ denn auch wie in den besten stummen Zeiten, sie gleitet von Figur zu Figur, von Dekoration zu Motiv – die hohe Schule der Kamerakünstelei – über noble Bauten (Neppach und Scharf) durch interessante Atmosphären, die offenbar zum literarischen Film-Paris-Komplex gehören (die Regenszenen siehe René Clair).
Das Mikrophon und was für dieses bissige Etwas berechnet ist, wirkt weniger virtuos. Obgleich auch da namentlich im Schnitt – des jetzt übrigens recht zusammengeschnittenen Films – manches auffällt – zumal in allen Szenen mit Hans Peppler, der das an sich gut ausgewählte Ensemble durch viele Temperaments-Grade übertrifft.
Er hat einen nachballenden, brutalen Ton, ein ungemütlicher Kerl, der mit Ivan Petrovich, dem Beau, dem man das Sprechen verbieten sollte, wenigstens eine breite Szene hat, in der er sich enfalten kann, ein Nachtgespräch beim Ausziehen, ein wirklich gelungenes Stück.
Mit den übrigen reproduziert Mittler viel Abgegucktes wieder, namentlich in den Rennszenen, in denen Carl Ettlinger und Senta Söneland angenehm, auffallen.
Wiederholt bleibt Mittlers Regie stecken, mit Hanna Waag hat er nichts anzufangen gewußt, auch bei Hanna Ralph deckt sich der optische Ausdruck nicht mit der Sprachführung. Rolf von Goth wirkt auch hier sympathisch. Lustige Ansätze einer schlecht gezeichneten Figur bringt Carl Huszar-Puffy. Nebenher noch viele Namen und viel Aufwand.
In seiner jetzigen Gestalt ist der Film für das deutsche Kino kein verlorener, aber ein kräftiges Beiprogramm muß den Film ergänzen.